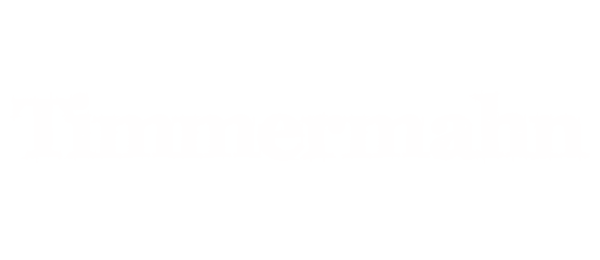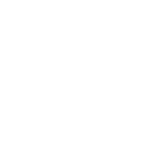Das letzte Bild im Bilderland
Jetzt hat er die Grenze erreicht. Aber noch keineswegs überschritten. Er hat sein letztes Bild gemalt, das allerletzte in einer ganzen Reihe, in einer schier unübersichtlichen Reihe, die er während Jahrzehnten mit Pinsel und Fantasie verfolgte, als ob er malend einen langen Tripp, eine Lebensreise machen würde, dem Unvorgesehenen ebenso sich öffnend wie dem, was ihn immer wieder weiter trieb. Das letzte Bild also: Datiert auf das Jahr 2034, unterschrieben, wie immer, mit „Timmermahn“. Nochmals huldigt der Maler und Erzähler darauf Picasso, von dem man sagen muss: Der Spanier hat von Timmermahn viel gelernt – jedenfalls, wenn man den Bildern Glauben schenkt, die der Rüeggisberger gemalt hat, Picasso zeigend, dem Timmermahn den Pinsel lenkt. Das ist keine Flunkerei, denn Timmermahn flunkert nicht. Er fantasiert nur, was auch sein könnte, was auch hätte sein können, dem Gang der Zeit ein Schnippchen schlagend. Ebenso mit seinem letzten Bild.
92-jährig, beinahe – und genau so alt wie Picasso, als dieser starb – wird Timmermahn dannzumal gewesen sein, wenn er dieses Bild gemalt haben wird, das jetzt bereits gemalt ist. Das Bild ist eine Lebens-Setzung, wie denn überhaupt alle seine Bilder, so glaube ich, Lebens-Setzungen sind: Ins-Leben-Setzungen. Timmermahn setzt sich mit seinen Bildern ins Leben, mit seinen Theaterstücken setzt er sich ins Leben, mitten hinein – und immer nebenan. Das ist sein Wille. Niemand sonst würde sein letztes Bild bereits gemalt haben, jedermann hätte die Angst, die Bilder dazwischen – zwischen dem Jetzt und dem letzten, dem allerletzten Bild – nicht mehr malen zu können. Vor dem allerallerletzten Bild, dem Bild, das er unmöglich mehr malen wird können: Timmermahn hat davor keine Angst.
Wie er auch keine Angst davor hat, seine Bilder könnten zu ernst sein; wie er denn auch keine Furcht davor hat, seine Bilder könnten zu unernst sein. Denn wenn er vom Ernst (der Bilder, des Lebens) spricht, sagt er sogleich: Das ist nicht so ernst. Aber genau das meint er ernst. Wie er seinen Tod ernst nimmt, wenn er sein letztes Bild bereits gemalt hat. Wie er sein Leben ernst nimmt, wenn er weiter malt.
Darin ist er ein Grossmeister. Darin ist er ein Kleinmeister. Das will erklärt sein, obschon Timmermahn sich selbst erklärt in seinen Bildern und Texten. Aber er ruft geradezu nach einem ständigen Wie: Wie denn das? Wie denn überhaupt, warum?
Weil. Einfach so.
Eigentlich heisst Timmermahn ja Klein, Tim Klein. Weil er das nicht sein wollte und konnte, weil er anders war und sein wollte, mahnte er den Wahn an, nur so ein klein wenig. Niemals würde er, der den Grossgrossgrossgott Wölfli Adolf unnachahmlich nachahmen kann, sich Timmerwahn genannt haben. Was nicht ausschliesst, dass er in seinen in der Psychiatrischen Klinik entstandenen Zeichnungen nicht das Flirren und die grosse Chaos-Ordnung des Wahns zugelassen hätte – als ein weiteres Experiment, als weitere Lebens-Setzung. Keine Art Brut also, eher ein Art Brutismus: Das Spiel mit den Grenzen, ohne je die Grenzen zu verwischen zwischen der Not, aus der heraus Wölfli produktiv wurde, und dem Drang nach Bildern, nach dem Land der Bilder, das alle Bildermacher antreibt, ob sie nun der Art Brut zugerechnet werden oder dem und jenem Segment im immer mehr ausufernden Markt der Bilder.
Klein also nicht. Und Wölfli nicht. Sicher kam es ihm jedoch auch nie in den Sinn, sich Gross zu nennen, was ja auch ein möglicher Künstlername hätte sein können: gross wie Picasso, gross wie Modigliani, gross wie Wölfli. All diese Namen beherrscht
Timmermahn auf ganzen Bildserien wie seine Harley, er fährt auf ihnen ab wie auf seinem schweren Motorrad. Fährt ab und weg, nach Amerika beispielsweise, wo er einem Indianer in einem der unsäglichen trostlosen Reservate mit einer Abbildung eines von ihm gemalten Indianerbildes den Mund öffnete. Und dann den Stein findet, den er für seine Frau gesucht hat wie ein Romantiker die Blaue Blume. Genau diese Offenheit nach vorn ist seine Grösse. Das ist er also: Timmermahn, der romantische Gross-Klein-Meister.
Wie gesagt: Das will erklärt sein. Gross ist seine Geste – vom Elefanten zum Mickey Mouse, vom Himmelsgewölbe bis zur Kokainlinie, vom Tachismus, den er als die einfachste Malart bezeichnet, bis zum Porträt, wo er die Verzweiflung im Akt des Malens nicht scheut, weil er den Menschen und den Dingen nahe, ganz nahe sein will. Und sich selbst auch. Und der Malerei: Zu seinen berührendsten Bildern gehören jene Leindwände, die er – ratsch, ahmt er den schwirrenden Ton nach – zerschnitt, mit einem Gestus, der, gewiss, an Lucio Fontana erinnern mag, jedoch mit einem ganz anderen Ziel sich ereignete. Timmermahn öffnete mit dem Schnitt nicht wie jener neue Räume. Sein nächster Schritt nach dem Schnitt war der der Heilung: Mit dicker Schnur, die ihn in die Finger schnitt, vernähte er die Leinwände wieder, und malend – wohl nicht zufällig in Farbtönen, welche an die Haut erinnern – versuchte er, diesen Heilungsprozess der Leinwand noch zu befördern.
Die Narben jedoch beliess er letztlich doch, Wunden, bloss und nackt, verletzend und verletzlich – wie er denn im Witz den Ernst belässt, in der Verzweiflung die Hoffnung, in der grossen Geste das Augenzwinkern.
Vielleicht liegt in der Sehnsucht nach dem Heilen Timmermahns Kleinmeisterei. Ursprünglich wird der Ausdruck ‚Kleinmeister’ in Bern ja für jene Veduttenmaler des 18. und 19. Jahrhunderts verwendet, die mit viel Können getreue Landschaftsansichten und Szenen aus dem Leben produzierten – die Liebe zum Detail schloss dabei eine grosse Produktivität nicht aus, galt es doch, die durch den aufkommenden Tourismus wachsende Nachfrage nach dem „richtigen“ Leben zu befriedigen. Ein Kleinmeister in dem Sinn – obwohl ebenfalls sehr produktiv – ist Timmermahn nicht. Er bedient zwar einen gewissen Hang zur Idylle, aber mit einem hohen Grad an Ironie wie im Stück „Die Sunneggers“. Timmermahns Kleinmeisterei – nicht nur in den Texten, sondern auch in den Bildern – gleicht eher jener von Robert Walser als jener der klassischen Kleinmeister.
Weshalb Robert Walser? Dem Bieler Schriftsteller und dem Maler-Schreiber Timmermahn ist ein Hang zum Understatement eigen. Damit verschaffen und erhalten sie sich die Freiheit, weder einer Einheit der Inhalte noch einer Einheit des Stils folgen zu müssen. Das wirkt naiv. Aber es ist nicht naiv, sondern eher listig. Wenn sie die heile Welt vorgaukeln, zeigen sie mit einer Gaukelei zweiten Grades, dass sie gaukeln. Wenn sie Versatzstücke aus der so genannten Volkskultur, aus der Kolportage und der Literatur verwenden, entsteht jene Mischung aus U- und E-Kultur, die sich nicht einordnen lässt und in der das Lachen und das Weinen, der Ueberschwang und die Ernüchternung nahe beieinander sind.
Damit kommt in die Walser-Timmermahn-Familie ein weiterer, der das Spiel von Kolportage, Ernst und Ironie, Verzweiflung und Sehnsucht auszukosten vermag: Endo Anaconda von Stiller Has. Dieser kann Balladen singen, wie Timmermahn Bilder malt, wie Walser Märchen erzählt. Sie drei sind Bewohner jenes unendlichen und letztlich unergründlichem Bilderlandes der Fantasie, das jenseits von Raum und Zeit sich erstreckt. Und dennoch mitten in den Raum und mitten in die Zeit hineinragt, sich dann
aber aus aus diesem schrecklichen und schönen, diesem banalen und doch so abgründigen Alltag – Sehnsucht nach Heilung? – immer wieder irgendwie zu befreien vermag. Das Bindeglied der zwei Welten und zugleich das Heilmittel ist die Ironie. Nicht die ätzende. Eher die Ironie, die sich liebevoll der Dinge annimmt, sich aber liebevoll nur gibt, weil die Sache – das Leben, der Tod, die Liebe, die Hoffnung und die Abgründigkeit – sonst denn doch allzu einfach wäre: dem Kitsch verfallen würde, den die drei mit Lust und Inbrunst zu umspielen wissen
Deswegen die Ironie – als Mittel zur Distanzierung, die erst die Nähe ermöglicht. Es ist Ironie im Sinne der Romantiker: Die Brüche sind kein Brechen, sondern eher ein Drängen nach vorn, Sehnsucht, wie Novalis schrieb, überall zu Hause zu sein. Die Ironie weiss um die Nutzlosigkeit dieses Unterfangens – und setzt es dennoch fort, indem sie sich malend, schreibend – wie auch immer – der Sinnlosigkeit widersetzt.
Denn die blaue Blume bleibt im Sinn haften wie bei Timmermahn jener Stein, den er reisend für seine Frau fand. Wie jenes letzte Bild, das ironisch das Ende der Suche vorwegnimmt und zugleich die Suche antreibt, Grenzen setzend, Grenzen beschwörend und dadurch überschreitend.
Immer ein Wie: ‚Wie’ wie Timmermahn.
Das letzte Bild ist nicht das letzte in Timmermahns Bilderland.
Höchstens das vorletzte.
Und dann ein Schnitt. Ein Schnitt in die Leinwand.
Auch er ist bereits da. Er öffnet neue Blicke in ein neues Bilderland.
Wer weiss es.
Wer weiss, wie.
Und was: Das letzte Bild ist, trotz allem, nicht gemalt. Noch timmer nicht.
Konrad Tobler